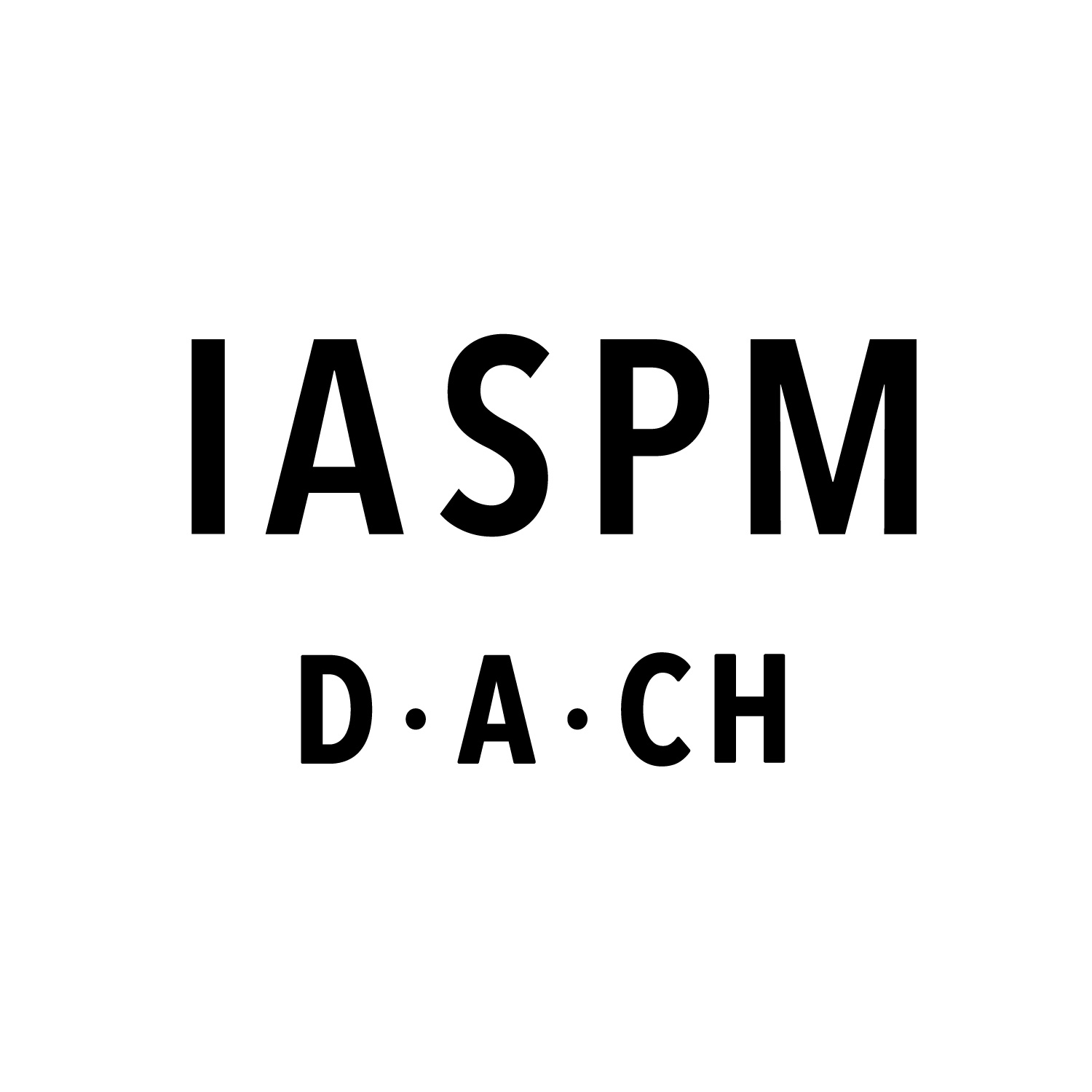Tagungsbericht Julian Schmitzberger
Ein schriller Ton schneidet durch den Saal und die Konferenz ist eröffnet. Wahrscheinlich fangen viele solcher Veranstaltungen mit einem ähnlichen Geräusch an, aber diese ist wohl eine der wenigen, bei der dieser Umstand fröhlich reflektiert wird. Den Anwesenden ist der Klang nicht nur vertraut, sie können ihn wahrscheinlich auch klassifizieren. Den meisten ist vermutlich bewusst, dass das Feedback, wie das unangenehme Pfeifen gemeinhin genannt wird, davon ausgelöst wurde, dass das Mikrofon der Moderation ungünstig Schall aus den Lautsprechern aufgefangen hat. Zwar kommen hier WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Disziplinen und Fachrichtungen zusammen, sie teilen jedoch ein Interesse: die Erforschung von populärer Musik.
Gleichzeitig findet noch eine weitere Rückkopplung statt, allerdings nicht akustischer, sondern biografischer Art. Denn im selben Raum, in dem Anja Brunner von der Universität Bern und Hannes Liechti von der hiesigen Hochschule der Künste gerade die dritte Konferenz der IASPM D-A-CH eröffnen, entstand wenige Jahre zuvor die Idee, den deutschsprachigen Zweig des internationalen Verbands zu gründen.
Musik, geografische Marker und die engen Verbindungen auch scheinbar disparater Vorgänge sollen das gesamte Wochenende über eine entscheidende Rolle spielen, schließlich versammelt man sich hier unter dem Leitgedanken „Pop – Power – Positions. Globale Beziehungen und populäre Musik“. Dass das Globale dabei nicht ohne Begrenzungen und Grenzziehungen zu denken ist, demonstrieren die geladenen Künstler Ali Gul Pir aus Pakistan und der Südafrikaner Umlilo, die im ersten Panel mit der Bookerin Laurence Desarzens über lokale Kämpfe und globale Communities diskutieren.
Der Rapper und Komiker Gul Pir hätte beinahe kein Visum für die Schweiz bekommen. In Südasien dreht er politische Videos über die Macht der Söhne feudaler Großgrundbesitzer, über die vulgäre Angewohnheit pakistanischer Männer, alles und alle schamlos anzustarren (was vom objektivierenden Blick auf Frauen bis zum wirkungslosen Angaffen von Ziegen reicht) oder über die Fehlleistungen der indischen Regierung, die staatliche Territorien überschreitende Brieftauben unter Spionageverdacht wegsperrt. Auch Gul Pir muss darauf achten, gewisse Grenzen einzuhalten. Denn wenn er seine Kritik nicht in angemessene Formeln presst, muss er ähnliche Maßnahmen fürchten. Satire darf in seiner Heimat längst nicht alles.
Umlilo hingegen, die selbsternannte „Diva of Future Kwaai“, bricht mit seinen Performances und Bühnenshows die Grenzen binärer Geschlechterordnungen auf, thematisiert aber ebenfalls in den Texten sexuelle Diskriminierung. Gerade im Kontext der Suburbs von Kapstadt sind queere Inszenierungen mehr als bunte Rauchbomben, sondern besitzen tatsächlich politische Sprengkraft, was nicht zuletzt daran deutlich wird, dass Umlilo bereits bei einem seiner Konzerte mit einem Messer bedroht wurde.
Die „safe spaces“, die er fordert, werden unter anderem von der Veranstalterin Desarzens garantiert, die zudem die Abteilung für Pop und Jazz an der Musikhochschule Lausanne leitet. Desarzens, die bekannt dafür ist, dass sie KünstlerInnen aus allen Kontinenten in die Schweiz bringt, betrachtet den Trend zu mehr Diversität im Popgeschäft aber eher kritisch. Die Tendenz, mehr Frauen als Männer für Festivals zu buchen, stellt für sie oftmals ein „women washing“ dar, da weibliche Künstlerinnen dennoch meist schlechter bezahlt würden als ihre männlichen Kollegen. Auch Umlilo hat manchmal das Gefühl, vor allem deswegen gebucht zu werden, um als afrikanischer Token die Line-Ups attraktiver zu gestalten.
Während in der Diskussionsrunde in erster Linie die Beschränkungen deutlich werden, mit denen progressive MusikerInnen auf internationalen Bühnen zu kämpfen haben, liefert die Keynote des ersten Konferenztages eine praktische Beweisführung für das oft nur vage umrissene Ermächtigungsargument. Jenny Fatou Mbaye von der City University in London referiert (übrigens ohne Mikrofonverstärkung, aber dennoch eindrucksvoll) über die Bedeutung von Hip Hop für zivilgesellschaftliche Entwicklungen in Südafrika. Beispielhaft zeigt sie die enge Verzahnung von „pop culture and public cultures“. Die Agenten des Wandels nennt sie in Anlehnung an das bekannte Videospiel „public space invaders“, wobei sie sich auf lokal erfolgreiche KünstlerInnen bezieht, die gezielt die öffentliche Meinung beeinflussen wollen, um das gemeinschaftliche Leben zu verbessern. Schließlich beendet sie ihr Plädoyer für die gesellschaftliche Kraft der Musik mit der Aufforderung, dass auch die Wissenschaft mehr hinterfragen sollte, für wen und in welchen Absichten Wissen produziert wird.
Der zweite Tag der Konferenz setzt mehrere thematische Schwerpunkte und bildet damit auch mögliche Positionen im globalen Gefüge ab. Während im großen Hörsaal zunächst über Pop im Fernsehen debattiert wird, später über (trans-)nationale Communities und schließlich über Demokratisierungsprozesse in der Musikwirtschaft, werden parallel Perspektiven auf die globale Clubkultur geboten – passenderweise im Untergeschoss des Gebäudes.
Die erste Session wird von Stefanie Alisch eröffnet, die in ihrem Vortrag musikalische Austauschprozesse zwischen Angolas Hauptstadt Luanda und Lissabon nachvollziehbar macht. Afrodiasporische Genres wie Kuduro, für deren Entwicklung europäische Einflüsse entscheidend waren, seien in den letzten Jahren zunehmend vereinnahmt worden, etwa von Bands wie Buraka Som Sistema, die den Stil neu etikettieren und musikalisch so modifizieren, dass er sich auf dem internationalen Markt besser verkauft. Aber auch portugiesische DJs und Producer ohne biografische Verbindungen erklären sich vermehrt zu authentischen Vertretern von angolanischen Sounds. Alisch diskutiert diese Hybridisierungsprozesse als „postcolonial schizophonia“ – dabei lässt sie jedoch offen, wie groß sie das analytische Potential des Begriffs einschätzt.
Vor ähnlichen konzeptuellen Herausforderungen steht Dahlia Borsche, die über ihre Feldforschungen zur Konstruktion von nationalen Identitäten durch elektronische Musik spricht. Zumindest ihre Gesprächspartner deklarieren das, was sie als Global House versteht, als eigenes Kulturgut, allerdings ohne dass sich dies in musikalischen Merkmalen oder distinktiven Praktiken widerspiegeln würde. So berufe man sich in Mexiko, wo Techno eigentlich als Importware gilt, in einer Blut-und-Boden-Rhetorik auf die angeborenen Talente für eine Musik, die üblicherweise durch eine One-World-Ideologie bestimmt wird. Auch in Südafrika scheinen manche ein eigenes Verständnis von „One Nation Under a Groove“ entwickelt zu haben. Letztlich macht Borsche postkoloniale Traumata dafür verantwortlich, dass ihre Akteure das Bedürfnis nach solchen Artikulationen haben.
Wie solche Diskurse über Zugehörigkeit und Differenz in Europa verhandelt werden, macht Bianca Ludewigs Vortrag deutlich. Sie untersucht transmediale Festivals experimenteller elektronischer Musik, die sich oft als Knotenpunkte in Netzwerken für politisch Engagierte verstehen. Doch Ludewig weist darauf hin, dass manche dieser Festivals in Fragen von Geschlechtergerechtigkeit anderen populären Festivals eher hinterherhinken. Anhand einer Bühnenkritik zu einem Avantgarde-Festival in Berlin kann sie zudem zeigen, dass auch das Streben nach Kosmopolitismus und die bewusste Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit sowie die daraus resultierende Übernahme von Verantwortung, nicht gegen Exotismen immunisiert und letztlich mehr Reflex sind als Vorkampf einer geistigen Entwicklung.
Von EDM-Stars, die sich selbst exotisieren, wie dem aus Neu Dehli stammenden Nucleya, aber auch von religiösen und nationalistischen Motiven in der indischen elektronischen Tanzmusik berichtet am Nachmittag Chris McGuinness, der aus New York angereist ist. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Liberalisierung des Landes versuchen viele junge MusikerInnen aus Indien durch Homerecording-Produktionen sozial aufzusteigen, jedoch schaffen es – wie anderswo – nur wenige zum großen Ruhm, dafür manche zum Status von Ghost Producern in internationalen Netzwerken. Aber nicht nur jene, die als Geister komponieren, sondern auch Hindus, die das Spirituelle verstärken wollen, bedienen sich der erschwinglich gewordenen Produktionsmittel der Clubkultur und engagieren mittlerweile lokale Sound Systems für religiöse Festivals.
Zwischen den Vorträgen laufen im Erdgeschoss derweil ikonische Klänge im Loop. Durch die interaktive Soundinstallation „Arkestrated Rhythmachine Komplexities – Travelling Drum Machines“ von Johannes Ismaiel-Wendt und Malte Pelleter kann man erfahren, wie die Geschichte von Rhythmusmaschinen aus den 1950er bis -80er Jahren zugleich die Geschichte der rassistischen Ausbeutung sichtbar und hörbar werden lässt. Denn auch etwa die Aufschriften über den Schalterleisten der analogen Maschinen verraten vieles über die Migration musikalischer Formen und über Aneignungen von fremd- und andersartigen Stilelementen. Die rhythmischen Reisewege der Drum-Patterns sind als Spuren des Black Atlantic zu lesen, dem postkolonialen Atlas, der die traumatischen Routen der Sklaverei nachzeichnet. Jenseits von territorialer Verortung und linearen Erzählweisen kann man hier Antworten darauf finden, wie der Bossa Nova erfunden wurde oder wie durch Stevie Wonder der Soul in die Maschine kam.
Am letzten Tag der Konferenz stehen dagegen weniger transnationale Austauschprozesse und Wechselwirkungen im Fokus, die Analysen verbleiben tendenziell vielmehr auf nationaler Ebene. Darci Sprengel hält einen Vortrag über die unabhängige Musikszene Ägyptens, die nach den gesellschaftlichen Umbrüchen des Arabischen Frühlings entstand. Laut Sprengels Beobachtungen meiden viele ägyptische MusikerInnen politische Inhalte. Diskursive Kritik und öffentlicher Protest wird abgelehnt, da man sich das Scheitern der Revolution durch eine zu hohe gesellschaftliche Polarisation erklärt. Statt der Regierung wird die Schuld bei der Bevölkerung gesucht, die man durch die „energy“ und die „vibration“ von Straßenkonzerten vereinen will. Dieses Verlangen nach einer von Antagonismen bereinigten, spirituellen Kultur ist für Sprengel gleichwohl keine Überwindung von Ideologie, sondern selbst ideologisch. Die „uplifting“ Effekte stellen keinen einen präkulturellen Universalismus dar, argumentiert Sprengel, sondern bleiben stets mit sozialen Bedeutungen verbunden und sind in soziale Kontexte eingebunden. „Masses need to be uplifted to somewhere.“
In Pedro Oliveiras Beitrag geht es im Prinzip nur um eine bestimmte Jukebox. Sie steht vor einer Bar in einer der Favelas Rio de Janeiros, in denen es insgesamt mehr als 20.000 vergleichbarer Jukeboxen geben soll. Oliveira bestimmt die kulturelle Rolle und Bedeutung dieser Automaten, die längst nicht mehr mit Münzen gefüttert werden müssen, sondern so modifiziert werden können, dass sie auch selbstgewählte Musik abspielen. Diese Eigenschaft macht die Jukeboxen zu Verstärkern von sozialen Botschaften und Talk-Back-Einrichtungen der Stimmlosen in einem Umfeld, das nach Oliveira von „listening anxieties“ geprägt ist. Sie werden so zum Ort des Durchbruchs für DJs und MCs, zum Kommunikationsmittel für Gangs aus Drogendealern, aber auch zu sonischen Markern für gewalttätige Operationen der Militärpolizei, wenn Waffengeräusche oder Nachrichtenausschnitte zu hören sind.
Im Rückbezug auf postkoloniale und psychoanalytische Ansätze sowie Konzepten aus der Performance-Theorie versucht Steffen Just die Ära des Musiktheaters von 1890-1930 subjekttheoretisch zu fassen. Vor der Zeit der großen Massenmedien machte das europäische Musiktheater mit Schleiertänzen und rassistischen Minstrel-Shows Stereotypisierungen populär. In den Reaktionen auf solche Vorführungen sieht Just eine Art Fetisch, der sich zum einen aus einem Drang zur Abgrenzung gegenüber den kulturell Anderen nährt, was koloniale Machtverhältnisse stabilisiert und zur Selbstvergewisserung dient, sich aber ebenso aus einer Faszination für die tabuisierten Exzesse und den hedonistischen Genuss speist, den die Fremden verkörpern können und welche dem weißen, bürgerlichen Ich jener Zeit untersagt sind.
Schließlich liefert Melanie Schiller eine bestechende Fallstudie des sogenannten Trizonesien-Songs, einer Karnevalshymne von 1948, die zeitweise die Funktion einer Hymne für einen deutschen Nationalstaat übernahm, den es zu dieser Zeit offiziell gar nicht gab. Am ersten Kölner Karneval nach Kriegsende feierten die fröhlichen „Eingeborenen von Trizonesien“ (einer Ableitung der Trizone der drei Besatzungsmächte des Westens) ihren Status als unschuldige Kolonisierte, die sich die Zeiten der Unabhängigkeit zurückwünschen. Unterhaltungsmusik, die damals weitgehend als apolitisch galt, wurde so zum Ventil, das es möglich machte, mit Spaß und Ironie zu einem patriotischen Nationalbewusstsein zu gelangen.
Mit einer Bewegung vom Globalen zum Transnationalen hin zur Nation endet damit dieser Durchgang durch das Programm der dritten IASPM D-A-CH Tagung. Dabei ist dies nur eine mögliche Bewegung unter vielen. Zum einen wurden noch viele weitere Präsentationen gehalten, zum Beispiel darüber, wie man die Digitalisierung von Musik im Lichte der Kritischen Theorie verstehen kann. Zum anderen – und das ist wohl die entscheidende Einsicht, die diese drei Tage in Bern vermitteln konnten – werden auch lokale, regionale oder nationale Ereignisse aussagekräftiger, wenn man sie in ihrer Verwobenheit mit und ihrer Abhängigkeit von weltumspannenden Entwicklungen und Prozessen begreift.